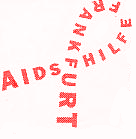Crack-Street-Projekt
ein Kooperationsmodell
von Drogenhilfe - Jugendhilfe - Medizin
|
Drogenhilfe |
|
Jugendhilfe |
|
Medizin |
|
|
|
|
|
|
|
La Strada |
|
Walkman |
|
Schieleambulanz |
|
|
|
|
|
Das Crack-Street-Projekt
Das Crack-Street-Projekt ist ein interdisziplinäres Team aus MitarbeiterInnen von Jugendhilfe, Drogenhilfe und Medizin, das KonsumentInnen von Crack in der Frankfurter Straßen-Drogenszene aufsucht. Auftrag- und Geldgeber für die drei beteiligten Träger sind Frankfurter Drogenreferat und Jugendamt. Das ergab sich aus der langjährigen Zusammenarbeit der verschiedenen städtischen Stellen, vor allem aus der Kooperation der niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen mit Polizei und Justiz. Im entsprechenden Abstimmungsgremium, der sogenannten Montagsrunde, wurde im Laufe des Jahres 1997 der zunehmende Crackkonsum und die steigende Auffälligkeit der KonsumentInnen thematisiert. Um das Ausmaß des Problems und die Erreichbarkeit der Zielgruppe zu untersuchen, wurde ein Streetwork-Projekt installiert.
Die Träger dieses Projektes wurden ausgewählt, weil sie sich bereits mit dem Problem des zunehmenden Crack-Konsums in Frankfurt auseinandergesetzt hatten. Von Seiten des Jugendamtes und der dazugehörigen Straßensozialarbeiter wurde schon seit etwa 1993 der Crack-Konsum von Jugendlichen in der Straßenszene thematisiert. Auch in Hamburg wiesen Mitarbeiter des Basis-Projekts frühzeitig auf den Crack-Konsum besonders bei Jugendlichen hin. Die Ausgrenzung von drogenkonsumierenden Jugendlichen aus den Einrichtungen der Jugendhilfe machte es in beiden Städten unumgänglich, das Problem offensiv anzugehen. In Frankfurt war die Crack-Szene zu diesem Zeitpunkt auch noch klar von der Szene der älteren Opiatabhängigen getrennt.
Mit dem zunehmenden Crack-Konsum auch bei Opiatabhängigen und Substituierten Mitte der 90er Jahre vermehrten sich die Probleme in den Einrichtungen der Drogenhilfe. In den Substitutionsambulanzen wurde bei einer wachsenden Zahl von Patienten ein massiver Kokainbeigebrauch festgestellt. Parallel dazu stieg die Zahl der psychiatrischen Diagnosen und Überweisungen zu entsprechenden Fachärzten. Die Verhaltensauffälligkeiten der KlientInnen führten zu Schwierigkeiten im Einrichtungsablauf, sowohl in den Ambulanzen wie auch in niedrigschwelligen Anlaufstellen. Es gab mehr Hausverbote für den Rahmen dieser Einrichtungen sprengendes, hoch aggressives Verhalten. Als Ursache dieser Entwicklung galt ein vermehrter intravenöser Konsum von Kokain. MitarbeiterInnen der niedrigschwelligen Einrichtungen führten die Veränderung jedoch auf eine neue Konsumform zurück: auf das Rauchen von Kokain. Besonders die später am Crack-Street-Projekt beteiligten Institutionen versuchten durch konzeptionelle Überlegungen und Veränderungen auch diesen Teil ihrer Klientel zu erreichen.
Drei Träger wurden beauftragt, jeweils zwei Mitarbeiter zu benennen, die im Rahmen des Crack-Street-Projektes auf die Straße gehen sollten. Die beteiligten Einrichtungen sind für die AIDS-Hilfe der Drogenhilfe-Kontaktladen "La Strada" (mit Konsum- und Übernachtungsmöglichkeit), für die Jugendhilfe das Streetworkprojekt "Walkman" (angegliedert zunächst beim Jugendamt, dann in die neu gegründete städtische Gesellschaft "Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" überführt) und für die Malteser die Substitutionsambulanz in der Schielestraße. Sowohl für die Sozialarbeiter von La Strada und Walkman, wie auch für die Ärzte der Malteser wurde jeweils eine halbe Stelle für die Mitarbeit am Crack-Street-Projekt zur Verfügung gestellt. Diese Zeitkapazitäten wurden in den vergangenen fünf Jahren beibehalten, auch wenn in allen beteiligten Einrichtungen viel zusätzliche Arbeit investiert werden musste. Inzwischen gehen wir davon aus, dass eine Stunde auf der Straße eine weitere Stunde an Folgearbeiten verursacht.
Geschichte des Projektes
Der zu Beginn der 90er entwickelte "Frankfurter Weg" beinhaltete einen engen Austausch der verschiedenen Institutionen, die – ob repressiv oder helfend – mit der Drogenszene am Frankfurter Hauptbahnhof zu tun hatten. Daher suchte man in der "Montagsrunde", in der sich die VertreterInnen der unterschiedlichen Institutionen miteinander abstimmten, bald nach Möglichkeiten, auf die durch das Auftauchen von Crack veränderte Situation zu reagieren.
Die Frankfurter Polizei begann 1997 Crack in der Sicherstellungsstatistik gesondert auszuweisen. Auch KonsumentInnen dieser Droge wurden jetzt als solche erfasst. Dadurch geriet dieses Problem zunehmend in den Blick und das machte Handlungsbedarf deutlich. Seitens der Polizei wurde Ende des Jahres eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die das Dunkelfeld in diesem Bereich zunehmend "ausleuchtete". Drogenreferat und Jugendamt verständigten sich daraufhin, von Seiten der entsprechenden Hilfesysteme gezielt auf diese Personengruppe zuzugehen.
Die Entstehung des "Crack-Street-Projektes" wurde beschlossen. Um das Ausmaß des Problems und Besonderheiten der Szene zu evaluieren, sowie um Ansätze für Hilfsangebote zu entwickeln, begann zunächst eine dreimonatigen Probephase. In deren Vorfeld bewegten sich die Vorstellungen zum Crack-Street-Projekt zwischen dem extrem einzelfallorientierten Arbeitsansatz der Jugendhilfe und den Konzepten, mit denen in den 80er Jahren auf die offene Szene der Opiatabhängigen zugegangen worden war. So wurde dem Projekt ein Bus zur Verfügung gestellt, der eigentlich dazu vorgesehen war, "in die Crack-Szene" zu fahren und sie mit Iso-Drinks und anderen gesunden Sachen zu versorgen. Dieses Konzept wurde allerdings nicht in die Tat umgesetzt, da es keine größeren Ansammlungen von KonsumentInnen gab. Der schnelle Handel und Konsum von Crack fand vielmehr in kleinen hektischen Grüppchen statt. Der relativ große Druck der Polizei führte dazu, dass wir anfangs einen "Kripo-Effekt" verursachten. Da wir zu mehreren Personen durch die Straßen zogen und Interesse an den Crack-KonsumentInnen zeigten, war für sie klar, dass wir von der Polizei sein müssten. Unser Erscheinen vertrieb häufig genug die KonsumentInnen genauso wie das Auftreten der Kriminalpolizei.
Über die situationsangemessene Angst vor der Polizei hinaus, führt der Crackkonsum zur Verstärkung paranoider Tendenzen, so dass ein allgemeines Angebot an die Szene scheitern muss. Der persönliche Zugang zu einzelnen KlientInnen war also die wesentliche Arbeitsgrundlage. Den mehr oder weniger engen Kontakt aller MitarbeiterInnen des Projektes aus ihrer sonstigen Tätigkeit zu den verschiedenen Teilgruppen konnten wir einsetzen, um relativ schnell einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen.
Die Ärzte kannten vor allem substituierte KonsumentInnen, ältere Opiatabhängige waren häufig den MitarbeiterInnen aus dem Kontaktladen der Aidshilfe bekannt und die meisten Minderjährigen und jungen Erwachsenen hatten einen engen Kontakt zu den MitarbeiterInnen von WALK MAN. Nur die Gruppe der illegalisierten MigrantInnen war für uns praktisch unzugänglich. Die uns bekannten KlientInnen mussten in der Regel nach einem Kontakt zu uns den jeweils Umstehenden erklären, dass wir Sozialarbeiter seien, um den naheliegenden Verdacht der Zusammenarbeit mit der Polizei zu vermeiden. Der direkte Zugang zu den Leuten beruhte zu Beginn auf der Arbeit in unseren bisherigen Tätigkeitsfeldern. Erst nach und nach ließ sich eine tragfähige Vertrauensebene zu vielen Einzelpersonen aus der Gruppe der Crack-KonsumentInnen schaffen.
Die Probephase von September bis Dezember 1997 zeigte, dass die Konsumentlnnen von Crack sowohl erreichbar als auch hilfebedürftig waren. In Absprache zwischen Drogenreferat und Jugendamt wurde folglich beschlossen, das Projekt zunächst weiterzuführen und den beiden Auftraggebern regelmäßig Bericht über die Arbeit und Veränderungen auf der Szene zu erstatten. So mussten die Vorstellungen über die Herangehensweise an eine geschlossene "Konsumentengruppe" revidiert werden. Dies stellte auch innerhalb des Projektes einen längeren Prozess dar, in dessen Verlauf die bewussten und unbewussten Prämissen der eigenen Arbeit durch die enge Kooperation im Projekt deutlich wurden. Die Ansätze der verschiedenen Disziplinen zeigten sich beispielsweise im Umgang mit dem geringen Handgeld, das uns zur Verfügung gestellt wurde, aber auch in der Vorstellung davon, wann ein Gespräch beendet werden konnte oder wie weit den einzelnen KlientInnen nachgelaufen werden musste. Auch die Definitionen erfolgreicher Arbeit unterschieden sich und wurden in der täglichen Praxis immer wieder hinterfragt.
Die intensive Zusammenarbeit auf der Straße ermöglichte es dem Team, diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten so zu reflektieren, dass sich eine harmonische Arbeitsebene entwickeln konnte. Der gemeinsame Wunsch, für die KlientInnen positive Veränderungen zu erreichen, schuf eine tatsächlich interdisziplinäre Basis für dieses Projekt. Die Tatsache, dass wir alle unsere Voraussetzungen immer wieder überprüfen und einander vermitteln mussten, führte auch zu klareren Vorstellungen über die eigene Arbeit.
Früh zeigte sich, dass die Zielgruppe des Projektes Beziehungsarbeit notwendig machte. Jede positive Situationsveränderung erfordert eine besondere Vertrauensbasis zu den Mitarbeitern des Projektes. Erst, wenn der einzelne Klient konkrete Erfahrungen mit einem bestimmten Mitarbeiter eines Streetworkprojekts gemacht hat, lässt sich diese Basis herstellen. Die Persönlichkeit jedes Teammitglieds ist eine wesentliche Voraussetzung hierfür. Sowohl für den fachlichen Austausch, als auch für die Möglichkeit des langfristigen Beziehungsaufbaus war es uns besonders wichtig, mit den gleichen MitarbeiterInnen möglichst über einen längeren Zeitraum mit dieser Zielgruppe zu arbeiten. Entsprechend versuchten wir im Rahmen der Möglichkeiten eine personelle Kontinuität aufrecht zu erhalten.
Dennoch stattfindende Stellenwechsel nutzten wir, um aus dem zu Beginn rein männlichen Projekt ein inzwischen geschlechtsparitätisch besetztes zu machen. Diese Entwicklung hat nicht nur Folgen für die Form der Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Der Zugang zu den KonsumentInnen hat sich hierdurch deutlich verbessert und intensiviert. Vor allem Crack-Konsumentinnen prostituieren sich unter extrem problematischen Bedingungen. Sie können ihre Arbeitsbedingungen auf dem Straßenstrich kaum kontrollieren, da die Gier nach der Droge wesentlich größer als bei den Opiatabhängigen ist. In Frankfurt bezahlen Freier mittlerweile direkt mit Crack, so dass die Frauen noch stärker veranlasst sind, jede Vorsicht zu verdrängen.
Arbeitsziele
Zentrales gemeinsames Ziel aller beteiligten MitarbeiterInnen ist die konkrete Verbesserung der Lebenssituation und des Gesundheitszustandes der von uns betreuten einzelnen KlientInnen.
Da wir Streetwork in der Straßenszene machen, handelt es sich hierbei um Crack-KonsumentInnen, die in oder am Rande der Obdachlosigkeit leben und ihren Drogenkonsum in der Regel nicht kontrollieren können. Sozial integrierte Crack-KonsumentInnen sind über diesen Arbeitsansatz nur in Ausnahmefällen erreichbar, da sie sich auf der Szene höchstens mit ihrer Droge versorgen.
Verbesserung der Lebenssituation heißt deshalb für unsere Zielgruppe zunächst, dass wir versuchen, Wege zur wenigstens minimalen Befriedigung der Grundbedürfnisse zu finden und aufzuzeigen. Hierzu zählen sowohl die medizinische Versorgung (etwa Verbandswechsel bei offenen Beinen, die Medikation etwa bei Lungenentzündungen etc.) auf der Straße (ansonsten die kurzfristige Begleitung zu Ambulanzen oder Fachärzten), die Versorgung jüngerer KlientInnen mit Essensgutscheinen für das "Café Fix" oder älterer KonsumentInnen mit Döner, Hamburger etc., die kurzfristige Vermittlung oder Begleitung zu den bestehenden Notübernachtungsmöglichkeiten und die minimale Versorgung mit legalen Ressourcen für Tabak, Trinken, Fahrkarten etc.
Dabei ist uns klar, dass eine grundlegende Verbesserung der Situation nur außerhalb der Szene erreichbar ist. Bleibt der dauerhaft zentrale Lebensort das Bahnhofsviertel, können unsere "Versorgungsangebote" nur eine kurzfristige Entlastung für die KlientInnen bringen. In einer Reihe von Fällen führt dieses hilflose Unterstützen aber längerfristig dazu, eine Basis für eine grundlegende Veränderungsbereitschaft zu schaffen. Diese kann durch (geringfügige) äußere Ereignisse angestoßen werden.
Gerade dann ist es aber wichtig, ad hoc weitergehende Hilfen anbieten und diese Perspektive aufrechterhalten zu können. Dafür ist es notwendig, veränderungsbereite KlientInnen auch in Einrichtungen, JVAs, Krankenhäusern aufzusuchen und nicht darauf zu warten, dass sie erst wieder in die Szene zurückkehren. Hier wäre eine weitergehende Flexibilisierung der Hilfsangebote nützlich.
Im Bereich der Jugendhilfe ist der Weg aus der Szene heraus relativ leicht zu bewerkstelligen, da es verschiedenste Angebote hierfür gibt. Aber auch bei den älteren KonsumentInnen gibt es immer wieder die Möglichkeit, eine Entwicklung außerhalb der Szene anzustoßen. Hierzu sind allerdings viel größere Anstrengungen der betroffenen KonsumentInnen nötig, so dass häufig mehrere Anläufe erforderlich sind, um die von uns angestrebte Veränderung zu erreichen. Dies setzt die Offenheit der MitarbeiterInnen für die weitere Arbeit mit (zum Teil auch hoffnungslos erscheinenden) Fällen voraus. Die "misslungenen" Versuche sehen wir dabei als einen Teil eines längeren Prozesses, der aus Fort- und Rückschritten besteht. Beides sind notwendige Bestandteile und beide tragen im Endeffekt zu einem positiven Ergebnis bei.
Drogenszene in Frankfurt
In den 80er Jahren hatte sich die offene Drogenszene in Frankfurt in einer Grünanlage zwischen den Bankentürmen festgesetzt. Nach unterschiedlichen Schätzungen versorgten sich in der "Taunusanlage" bis zu 7.000 oder 10.000 KonsumentInnen mit harten Drogen. Dauerhaft hielten sich dort mehrere hundert, phasenweise bis zu 1.000 Menschen gleichzeitig auf und handelten, vermittelten oder konsumierten offen, vor allem Heroin. Sowohl die Stadtverwaltung wie auch interessierte Kreise aus der Frankfurter Bankenwelt entschieden Ende der 80er Jahre, diese Situation so nicht weiter hin zu nehmen. Die offene Szene wurde zunächst hin und her gescheucht.
Die Polizei erklärte jedoch klar, dass sie nicht in der Lage sei, das Problem an sich zu lösen. Entsprechend wurde die sogenannte "Auflösung der Taunusanlage", die verblüffend reibungslos von statten ging, von Hilfsangeboten für "Frankfurter" Drogenabhängige begleitet. Wesentliche Teile der Szene verlagerten sich in den Bereich um den Frankfurter Hauptbahnhof, wo auch die meisten Hilfsangebote eingerichtet wurden. Vorherrschend war zu diesem Zeitpunkt der intravenöse Konsum von Heroin und ein regelmäßiger Beikonsum von Benzodiazepinen und Kokain. Berüchtigt ist der sogenannte "Frankfurter (Cocktail)", der gleichzeitige Konsum dieser drei Stoffe, der den schnellen Kick von Kokain mit der dämpfenden, aber langsamer einsetzenden Wirkung der Beruhigungsmittel kombiniert.
In den 90er Jahren hatte sich die professionelle Bearbeitung des gesellschaftlichen "Drogenproblems" erfolgreich durchgesetzt. Durch Hilfsangebote von sozialarbeiterischer und medizinischer Seite konnten die jährlichen Todeszahlen, an denen allgemein anerkannt die Effektivität des Drogenhilfesystems gemessen wird, deutlich gesenkt werden. Dieser Erfolg verhinderte eine ernsthafte Auseinandersetzung über die theoretischen Grundlagen der gemeinsamen Arbeit, etwa den Krankheitsbegriff bei den Medizinern oder die Bedeutung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Für das Überleben der Menschen in der Szene waren aber sowohl die Ausbreitung der Methadon-/Polamidon-Substitution wie auch die Einrichtung von Konsumräumen eine zentrale Voraussetzung.
Crack
veränderte die SzeneMitte der 90er Jahre vollzog sich in der Frankfurter Drogenszene eine gravierende Veränderung. Jenseits der klar identifizierbaren, Spritzen gebrauchenden Drogenszene entwickelte sich in den 90er Jahren eine Szene von Crack-KonsumentInnen. Sowohl in Frankfurt wie später auch in Hamburg setzte sich Crack in der Straßenszene schließlich so weitgehend durch, dass kaum noch reine Opiatabhängige anzutreffen sind.
Bis Mitte der 90er Jahre wurde Kokain in der Frankfurter Drogenszene wie Heroin vor allem intravenös konsumiert. Als Crack in Frankfurt auftauchte, waren die abschreckenden Bilder von unmotiviert aggressiven und vollständig verelendeten Crack-Rauchern in den USA längst bekannt. Dennoch setzte sich der neue Stoff bei unterschiedlichen Konsumentengruppen durch. Langjährigen DrogenkonsumentInnen, bot Crack den Vorteil, viel billiger zu sein als das relativ teure Kokain. Junge KonsumentInnen ohne lange Drogenkarriere konnten dagegen mit Crack die Hemmschwelle zum Spritzen des Suchtstoffs umgehen. Crack verschaffte ihnen beim Rauchen den gleichen "Kick" wie der intravenöse Konsum, ohne sichtbare Einstichstellen.
1997 war die Crackszene in Frankfurt noch durch einen Straßenzug von den "Junkies" getrennt. 1998 vermischten sich beide Szenen vollständig. Inzwischen konsumiert jeder der mehreren hundert Personen der Straßen-Drogen-Szene auch Crack, zum Teil begleitet von einer Verringerung des Heroinkonsums. Reines Kokainpulver wird auf der Straßenszene praktisch nicht mehr gehandelt. Auch die mehreren tausend Personen, die sich regelmäßig um den Frankfurter Hauptbahnhof mit harten Drogen versorgen, rauchen in weiten Teilen Crack.
Im Gegensatz zum Konsum von Opiaten und Benzodiazepinen führt Crack bei den KonsumentInnen zu hektischer Betriebsamkeit, kaum kalkulierbarem Verhalten und gesteigerter Empfindsamkeit. Crack hat die Szene massiv beschleunigt und das Aggressionspotential gesteigert. Das stellte neue Anforderungen an das Hilfesystem.
Crack - Wirkungsweise und Stoffkunde
Kokain wirkt auf das zentrale Nervensystem, dort greift es in den Dopamin-Kreislauf ein. Kokainkonsum kann Stimmungsaufhellung bewirken, Selbstvertrauen steigern, das Redebedürfnis erhöhen, sowie Bewegungsdrang und Sinneseindrücke erheblich verstärken. Körperlich sind eine Verengung der Blutgefäße, geweitete Pupillen, erhöhte Temperatur, beschleunigter Puls und Blutdruckerhöhung die Folge. Für die Dauer der euphorisierenden Wirkung von Kokain kommt es zu einer Hyperstimulation, die Ermüdung verzögert und die Realitätswahrnehmung herabsetzt. Je schneller das Kokain vom Körper aufgenommen wird, desto kürzer ist die Wirkung. Bei der Aufnahme durch die Nase kann die Wirkung 15 bis 30 Minuten dauern. Beim Rauchen hält sie nur wenige Minuten an. Über die Lunge gelangt der Wirkstoff sehr viel schneller ins Gehirn und wirkt dort intensiver.
Crack ist rauchbar gemachtes Kokain.
Kokain lässt sich in der Form von pulverartigem Kokainhydrochlorid nicht rauchen. Um Kokain rauchbar zu machen, muss in einem chemischen Prozeß der Salzsäureanteil des Kokainhydrochlorids abgespalten werden. Wird dafür Ammoniak oder Äther benutzt, entsteht sogenanntes "Freebase". Ergebnis des mit Explosionsgefahr verbundenen Herstellungsprozesses ist kristallisierte freie Base, die zu Pulver verarbeitet wird. Freebase ist von Streckmitteln weitgehend frei, enthält aber meist einen Teil des bei der Herstellung verwendeten Ammoniaks.
Wird Kokain mit doppeltkohlensaurem Natrium und Wasser aufgekocht, bilden sich während des Trocknungsprozesses Klumpen, die als "Steine" oder "rocks" bezeichnet werden. Sie enthalten einen Großteil der vorher beigefügten Streckmittel und Verunreinigungen. Das knackende Geräusch, das während des Erhitzens entsteht, gab dem Stoff seinen Namen: Crack.
Beide Formen von Kokainbase verdampfen bereits bei relativ niedriger Temperatur und sind daher rauchbar. Für den Konsum werden Pfeifen, aber auch "Bleche" benutzt. In der Frankfurter Szene wird sprachlich zwischen beiden Stoffen kaum unterschieden. So hat sich die Bezeichnung "Baser" für die KonsumentInnen beider Formen rauchbaren Kokains durchgesetzt. Die Vorstellungen über den Reinheitsgehalt und die Wirkung von Freebase und Crack widersprechen sich teilweise vollständig. Freebase setzt allerdings eine gewisse Infrastruktur für die Herstellung und zeitnahen Konsum voraus. Herstellungsverfahren, Größe und Konsistenz von Crack-Steinen entsprechen dagegen viel eher den Bedingungen der Straßenszene.
Risiko
Crackkonsum erhöht die Risiken des Kokainmissbrauchs noch einmal um ein Vielfaches. Sofort nach dem Ende des Crack-Rausches, also wenige Minuten nach dem Rauchen, setzt eine oft heftige depressive Verstimmung ein. Um ihr zu entgehen setzt das hektische Bemühen ein, sich Geld und einem neuen "Stein" zu beschaffen. Essen, Trinken, Müdigkeit oder auch ernste körperliche Beschwerden spielen keine Rolle. Erst der völlige körperliche Zusammenbruch und eine plötzlich auftretende extreme Müdigkeit veranlasst viele Crack-User zur kurzfristigen Unterbrechung ihres Konsums.
Quellen
(http://141.2.61.48/zim/infektio/crack.htm - Seite vom Netz genommen)
http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/SUCHT/Kokain.shtml
font-size: 10pt; font-family: Trebuchet MS; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 6">http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/SUCHT/Kokain.shtml font-size: 10pt; font-family: Trebuchet MS; line-height: 100%; margin-top: 0; margin-bottom: 6">http://www.cocaine.org
06.04.07 by MoreStern